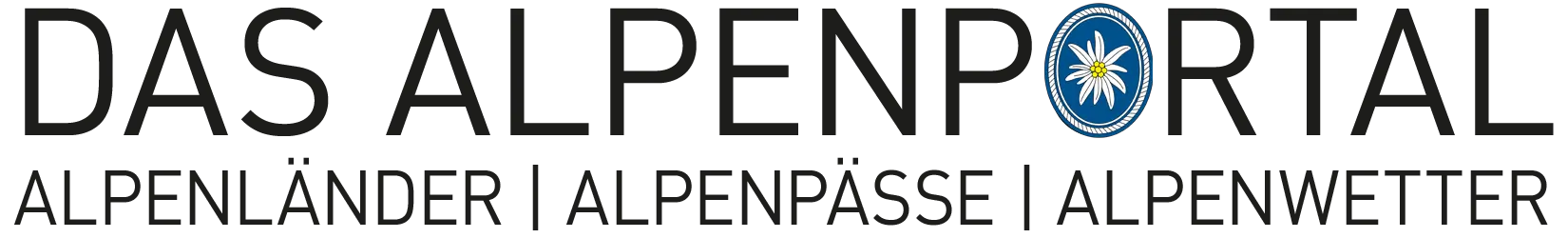In diesem Beitrag
Schlosspark hat sich die Region rund um Füssen auf die Fahnen geschrieben. Das bezieht sich natürlich auf die Schlösser der Wittelsbacher und den „Park“ zu ihren Füßen. Von allen Wittelsbachern ist Ludwig II. derjenige, dessen Leben und Sterben am Starnberger See bis heute am meisten fasziniert. Das Alpenjournal stellt hier vier Erlebnisse in der Region Schlosspark vor.
Sein Leben füllt ganze Bibliotheken: Ludwig II., im Volksmund „Märchenkönig“ oder „Kini“ genannt. Verrückt war er sicher nicht, ein kreativer Sonderling vielleicht. Er war hochgebildet, hat jede Nacht ein Buch gelesen. Und wer nachts arbeitet und tagsüber schläft, ist ja nicht per se verrückt. Außerdem spornte er, der Technikbegeisterte, die Ingenieure zu Höchstleistungen an.
Unter König Ludwig II. wurde der erste Lehrstuhl für Hygiene in Bayern eingerichtet. Seine Majestät hatte auf Schloss Neuschwanstein fließendes Wasser und eine Toilette mit Wasserspülung, die aussah wie ein Thron. Und das in einer Zeit, in der das Plumpsklo noch wenig nobel war: Erst 20 Jahre später gab es im Münchner Künstlerhotel „Marienbad“ – das 2024 für immer schließen musste – das erste Wasserklosett.

Der Kini war in Zeiten Bismarckschen Säbelrasselns sicher auch mit seiner Gesinnung fehl am Platz – er der Kunstsinnige! Er hat der Welt seine Schlösser hinterlassen. Tatsächlich der Welt, denn ohne Schloss Neuschwanstein wäre das Deutschlandbild im Ausland ein komplett anderes. In Freizeitparks auf der ganzen Welt ist das Zuckerbäckerschloss Model zum Inbegriff eines Schlosses geworden. Zu seinen Füßen und rund um den Schlosspark ist der massentouristische Auftrieb unvermeidbar, all die Asiaten mit ihren Selfiesticks sind nun mal weit gereist, um eben dieses Neuschwanstein zu sehen.
Aber nur wenige hundert Meter weiter liegt einem in diesem Schlosspark eine bezaubernde, stille Natur zu Füßen, in der man fast allein wandert und kaum glauben kann, dass das Zuckerbäckerschloss so nah ist. Man muss den Wittelsbachern einen guten Geschmack bescheinigen, denn dieser Winkel der Welt gehört zum Schönsten, was die Natur geschaffen hat. Am 10. Februar 1869 schrieb der Kini an Richard Wagner: „O wie sehne ich mich fort aus dem grässlichen Stadtgetriebe nach den lieben Bergen, denn auf den Bergen ist Freiheit und überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual“.
1. Kunstgriffe der Gartenarchitektur – Eine Wanderung rund um Schwangau
Der Schwangauer Kurpark auf dem Ehberg ist ein Unikat: Das gesamte Parkgelände im Schlosspark wurde einst als gemeinschaftliche Viehweide genutzt. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erwarb die Gemeinde nach und nach die kleinen Geländestücke von den einzelnen Bauern. 1936 begann der Architekt Alwin Seifert, Dozent für Gartenbau an der TH München, mit der Gestaltung im Sinne eines Englischen Gartens mit heimischen Pflanzen. Am Forggenseeufer entlang gelangt man nach Füssen, überragt vom Hohen Schloss. Es wurde 1291 von Ludwig dem Strengen begonnen. Das Schloss ist eines der bedeutendsten Profanbauten der deutschen Spätgotik mit der wunderbaren Scheinarchitektur im Hof und beherbergt auch eine Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Sie thematisiert die Bilder- und Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts.
Dazu gehörte auch das Streben hinaus in die Natur, eine, die wohl doch zu natürlich war und von den Gartenarchitekten umgestaltet werden sollte. Nachdem Kronprinz Maximilian, der spätere König Max II., Schloss Hohenschwangau fertiggestellt hatte, erwarb er weit drunten unter den steilen Felsen im Rohrachfilz Grundstücke. 1837 gab es bereits erste Pläne für einen Schlosspark von Carl August Sckell, dessen Onkel Ludwig Sckell den unvergleichlichen Englischen Garten in München schuf. Nach Sckells Tod übernahm Peter Joseph Lenné und gestaltete einen typischen englischen Landschaftspark, wo mit der Anlage von Solitärbäumen, mit Sichtachsen und mit Baumgruppen Weite und Größe vorgetäuscht werden sollte.

Alle Wege, die es heute in der Region Schlosspark gibt, existierten schon vor 160 Jahren. Wo heute die Füssener ihren „Stadtpark“ haben oder ihre Hundespaziermeile, da flanierte weiland die feine Gesellschaft durch den wunderbaren Schwanseepark. Nach dem Tode Maximilians II. verlor der Park seine Bedeutung, er ist heute ein Landschaftskleinod mit einer außerordentlichen Artenvielfalt!
Und deutlich tiefer gelegen, das merkt dejenige, der den Fischersteig hinauf wandert, der sich durchaus zackig in Serpentinen nach oben bis zu einem Abzweig nach Frauenstein windet. Das „castrum Frawenstein“ erschien erstmals 1290 in den Schriftquellen. Die Turmburg war die westlichste der vier benachbarten Burgen der mächtigen Herren von Schwanstein. Die einzelnen Familienzweige der Schwangauer lebten recht zerstritten auf ihren vier Ansitzen, im Spätmittelalter sollen einige schon mal ihre Beutel als Raubritter gefüllt haben. Frauenstein tauchte bis 1487 noch in Urkunden auf, dann wurde sie nach und nach abgebrochen, die Steine quasi recycelt.
Wenig ist noch übrig und doch ist das ein ganz eigener Platz dort oben in den Felsen – und wer dann wieder absteigt, erlebt den Kulturschock urplötzlich, wo die internationale Gästeschar die Schösser im Schlosspark bevölkert. Doch hinter dem kleinen Alpsee Freibad, das wie eine Badeanstalt aus anno dazumal, wird es ruhiger.

Immer wieder schweift der Blick zurück auf die Schlösser und recht alleine wandert man dahin auf der Westseite ganz nah am Wasser auf den Gitterstegen und ein verwunschenes Plätzchen tut sich auf. Dort, wo das Bächlein mündet, liegt ein Zauberwald, hier möchte man einen Fantasyfilm drehen. Auf der Nordseite steigt der Weg an, schmal, auch mal felsig – gut, dass die meisten Schlossbesucher mit ihren windigen Schuhen gar nicht auf die Idee kommen, hier zu wandern.
Der Trubel im Schlosspark ebbt erneut ab, wenn man von Hohenschwangau am Berghang entlang wandert und hinaus in die Ebene. Auf dem Bullachberg thront das vierte im Reigen der Schlösser, das neuerdings auch dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds gehört, einer Stiftung, die mit dem wunderhübschen Schloss achtsam umgehen wird.
Charakteristik
Eine weitgehend ebene Wanderung, Steigung am Fischersteig, etwas Trittsicherheit ist am Alpsee erforderlich, ca. 15 Kilometer lang, mit Muße und Pausen/Besichtigungen als Tagestour zu planen.
Einkehren
- Kiosk im Schwanseepark/Schwanseekiosk, direkt am Badesee
- Bar Alex, eine Wein- und Kaffeebar, die etwas Großstädtisches in die Fußgängerzone von Füssen bringt
- Die Füssener Kaffeerösterei bietet guten Kaffee in schöner Atmosphäre
- Das Schwangauer Brauhaus bietet leckere Helle und Deftiges als Grundlage
2. Die Mutter aller Mountainbiketouren – zwischen Halbammer und Halblech
Der Hohe Trauchberg in der Region Schlosspark hat nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag! Nur die Hohe Blaik ist als höchster Gipfel einen Eintrag wert. Genau genommen ist der Hohe Trauchberg eine Aneinanderreihung von Gipfeln, er ist ein bewaldeter Höhenrücken, der dem Klammspitzkamm im Norden vorgelagert ist. Und seine Umrundung ist so etwas wie die Mutter aller Mountainbike-Touren, moderat in den Steigungen und landschaftlich bezaubernd!

Sie beginnt in Trauchgau, einem schönen, bodenständigen Ort. Eine Reihe schöner alter Häuser säumen die Reichenstraße oder den Kirchplatz. Das wunderschön restaurierte Heislarhaus wird im Sommer oft zur Bühne für echte Volksmusik. Das Bauernhaus „Beim Hölzler“ ist seit 2000 ein Dorfmuseum mit liebevoll zusammengetragenen Exponaten: Geräte zur Flachsverarbeitung sind zu sehen, als das Allgäu noch lila war, bevor die Milchwirtschaft kam. Es geht um bäuerliche Wohnkultur und Handwerk, es gibt ein altes Schulzimmer und Wintersportgeräte, denn hier ist man nun mal dicht dran am Schnee.
Die ursprünglich hölzerne Andreaskirche wurde erstmals im Jahre 740 erwähnt. In der heutigen Kirche befinden sich Fresken und Altarbilder von Joseph Anton Keller aus Pfronten. Er begann 1819 mit der Ausschmückung. An der Decke des Kirchenschiffes prangt das Martyrium des heiligen Andreas mit dem typischen Andreaskreuz. Der Künstler, der viele Kirchen im Allgäu, aber auch in der Schweiz ausgemalt hat, war damals bereits 80 Jahre alt.
Die Tour im Schlosspark folgt dem Königssträßchen, dem „Königsstraßerl“. Wo weiland der Kini zwischen Linderhof und Neuschwanstein (meist nachts) mit seiner Kutsche unterwegs war. Des Königs Straße steigt mählich an, die höchste Stelle auf dem Königssträßchen liegt bei 923 Metern, es gibt zwei Bachdurchquerungen, die man aber bei normalen Wasserständen trockenen Fußes schafft. Man landet in Unternogg, ein Waldwinkel an der Halbammer, ein etwa 6,3 km langer, linker Zufluss der Ammer, die aus Bächen aus dem Ammergebirge gespeist wird. Ein Waldwinkel, der fein eingerahmt ist: im Süden liegen die Brunnenköpfe und die markante Klammspitze, im Norden die Hohe und Niedere Blaik.
Weiter geht es in der Region Schlosspark erst mal lauschig an der Halbammer entlang, der Wasserdost am Wegesrand bietet noch einer Vielzahl von Schmetterlingen und Wildbienen Nahrung. Wer mag, macht einen kurzen Abstecher zur kleinen Hubertuskapelle. Wo der Rottmeister Alletsee im Herbst 1902 Forstmeister Gröbl die Absicht mitgeteilt hat, am Wilden Jäger eine Kapelle zu errichten, weil er in 45 Jahren bei der schweren Holzarbeit mit Gottes Hilfe stets unverletzt geblieben ist.
Man kann hier um etwas Wadlschmalz bitten, fährt wieder das kurze Stück zurück und dann hinauf bis zur Mardersteig-Dienst-Hütte auf 1.144 Metern. Die Hütte ist privat, ein nettes Platzl, und kurz danach darf man auf keinen Fall den Steg verpassen, den es zu überqueren gilt. Am anderen Ende ist man dann auch schon wieder im Allgäu und damit im Schlosspark, auf Halblecher Flur. Ein paar Serpentinen tiefer tut sich dann eine wunderschöne Almlandschaft auf, ein paar Hütten auf den Almböden, die sich weit und anmutig zeigen.

Die Wasserscheide hier heroben im Schlosspark referiert darauf, dass die Bäche eben entweder zu Halbammer und Ammer ins Oberbayerische entwässern oder über Halblech und Lech ins Allgäu. Früher, bevor die Region von Forststraßen durchzogen war, hat man sich sehr genau überlegt, ob man sich diese Wildnis begeben wollte oder wie eine Tafel sagt: „Ein wilder Bär, ein Ochsentier gerieten aneinander hier, der Bär dacht, krieg ich mal nen Fraß. Der Ochs verstand jedoch keinen Spaß. Ein Kämpfen gabs voll Grimm und Wut, bis beide lagen tot im Blut.“
So geschah es 1630 am Ochsenkopf, und auch wenn ab und an ein Bär oder ein Wolf durchziehen, sollte man sich als Radler im Schlosspark eher auf große Bulldogs mit Rückewagen einstellen. Unvermindert geht es im Schlosspark nun talwärts, am Halblech entlang bis zur Reiselsbergerbrücke, wo dann mehr „Run“ von und zur Kenzenhütte zu erwarten ist und man auf den Kenzenbus achten sollte, der in Halblech startet.
Charakteristik
Diese Runde im Schlosspark ist 44 Kilomter lang und verläuft größtenteils auf feste Forstwegen und Asphaltpassagen. Geeignet für MTB/eMTB/Gravelbikes.
Einkehren
- Der Dorfwirt ist ein nettes Wirtshaus in Altenau
- Das Liftstüble in Halblech ist am Wochenende meist ab 13 Uhr geöffnet und bietet Brotzeiten und Kuchen an
- Die Trauchgauer Almstube ist toller Gasthof mit Tiroler Wirtsleuten, mit Biergarten, Kinderspielplatz und wunderbarer Küche. Von den hauseigenen Zebus gibt es auch Zebusteaks
- Der Gasthof Sera ist in Unterreithen ist bodenständig, hat einen Biergarten ist ist wochentags ab 17 Uhr, an Sonntagen ab 10 Uhr geöffnet
3. Fast wie ein Ufo – mit dem Bike zum Lieblingsplatz der Königin
Hohenschwangau war die heiß geliebte Sommerresidenz der königlichen Familie. Und die Frau Mama des Märchenkönigs, Königin Marie (1825 – 1889), war eine fanatische Bergsteigerin. Sie, eine Prinzessin von Preußen, schleppte den Sohn schon als Zehnjährigen auf das Älpele (1.530 m) und zwei Jahre später auf den Säuling (2.047 m), der als Berg gar nicht so ohne ist. Um 1850 hat König Maximilian II. das „Schweizerhaus“ für die bergnarrische Preisn-Gattin gebaut. Das heutige Berggasthaus Bleckenau, hat den Namen von den „Blecken“, altbayerisch für Huflattich. Zwölf Berghütten hatte Ludwig II. im Gebirge zwischen Lech und Isar, wo er sich zurückzog, die Kenzenhütte und die Bleckenau im Ammergebirge waren ihm Seelenorte im heutigen Schlosspark.
Gleich mal zach erhebt sich der Weg über Hohenschwangau bis zur Jugend. Hier ist nun wirklich internationales Touristengewusel, denn hier ist der Einstieg zur Marienbrücke. Aber es wird schnell stiller, wenn man der Pöllat folgt. Schöne Bäume, wunderbare Lichtspiele – die Bleckenau liegt dann anmutig auf 1167 Metern und wer es er hier schon gut sein lässt, und nur noch die Seele baumeln lassen will, macht nichts falsch. Wer noch weiter bergwärts zieht, kriegt nochmals einen zackigen Anstieg entlang der Pöllatschlucht geboten und strampelt weiter – dorthin, wo sich die Szenerie weitet, wo das Alpgebiet beginnt.
Und da war was los – am Abend des 6. April 2002. Der Weltuntergang? Der Angriff der Außerirdische? Ein Feuerball sauste über den Himmel, in Bayern klirrte so manches Fenster und so manche Vitrine. Kein Ufo, aber ein Meteorit, dessen Weg am Himmel vom „European Fireball Network“ im Schlosspark aufgenommen wurde. Das Feuerkugelnetz des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist ein Netzwerk von Kameras, das die Flugbahn eben genau dokumentiert hatte und damit das Einschlaggebiet berechnen konnten.

Etwa 100 Suchtrupps hatten sich zu Beginn auf die Suche nach den Meteoriten gemacht. Und just auf der Alpe, etwa sechs Kilometer vom Schloss Neuschwanstein Trubel entfernt fand man ein 1,75 Kilogramm schweres Stück, das auch gleich den Namen „Neuschwanstein Meteorit“ bekam. Der kosmische Felsbrocken gehörte wohl zu einem ganzen Schwarm, es wurden noch zwei in der weiteren Umgebung gefunden. Der Neuschwanstein Klumpen war je nach Quelle 48 Millionen Jahre oder 4,5 Milliarden Jahre alt. Aber in solchen Dimensionen interessieren ein paar Millionen Jahre ja auch nicht.
Die letzten knapp 100 Höhenmeter interessieren auch nicht mehr so sehr, bis man die Alpe Jägerhütte auf 1.422 Metern erreicht hat. Ein wunderbares Platzl im Schlosspark. Weit, anmutig auf den Wiesenmatten gelegen. Unterm Ochsenälpelekopf stehen Gämsen, auf der andern Seite dräut die Hochplatte, man ist „mibbadinna“ im Gebirge eben!
Charakteristik
Recht einfache Mountainbiketour, ca. 10,7 Kilometer lang
Einkehren
- Das Gasthaus Bleckenau ist nett und gemütlich
- Alpe Jägerhütte, ist urig und gemütlich. Getränke gibt es auch, wenn die Alm im Sommer beschickt wird
4. Keine Blue Jeans ohne den Kini –
ein Museumsbesuch bei den Wittelsbachern
Der technikbegeisterte Ludwig wollte für seine Blaue Grotte in Linderhof ein blaueres Blau, die Techniker tüftelten an Glasscheiben, aber nichts war blau genug. Schließlich fragte einer bei der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Ludwigshafen am Rhein an, ob man das Blau nicht chemisch herstellen könne. Vier Jahre nach Ludwigs Tod meldete die BASF ein Patent zur Herstellung von künstlichem Indigo an, einer Farbe, die später in den USA zum Färben von Jeans verwendet wurde. Diese hatte bekanntlich ein fränkischer Schneider aus Buttenheim erfunden: Levi Strauss. Die Welthose gäbe es nicht ohne einen Franken und nicht ohne einen Wittelsbacher.
Die Wittelsbacher sind eine Dynastie, ohne die Bayern nicht das wäre, was es ist. Deren Bautätigkeit München erst zu einer richtigen Stadt gemacht hat. Es ist klug, dass die Wittelsbacher mit diesem Museum der Bayerischen Könige auch sagen: Sehr her, uns gibt’s – und das Museum führt auf humorvolle Weise Geschichte und Geschichten zusammen. All die Fragmente bekommen hier einen Zusammenhang und eine Chronologie. Gleich zu Beginn glänzt Max‘ Tafelaufsatz. Klenze schuf die feuervergoldeten Bronzefiguren, es sind Motive aus dem Nibelungenlied. Es war ein opulentes Epos und es war gerade nach der napoleonischen Zeit auch identitätsstiftend, es war ein Sehnsuchtsepos der Deutschen.

Das Museum liegt im Brennpunkt, hier bei den Schlössern, es zeigt, was Schwangau für die Wittelsbacher und ihr Gefolge bedeutet hat. Es ist ein Museum mit einem klaren Raumkonzept, das eben mit dem Tafelaufsatz beginnt, der dann gleich nach der Eröffnung für alarmierende Zustände sorgte. Der Alarm ging los, nein, es waren keine Diebe, sondern Italiener, die ihre Kinder auf dem Tisch laufen ließen, weil die Italiener eben ein unverkrampftes Verhältnis zur Kultur haben.
Aber man kann auch ganz entspannt ins Museum gehen. Sich am Porträt Ottos von Griechenland erfreuen, der nach seinem Sturz irgendwie übrig blieb. Die Residenz in Bamberg war frei, und da brachte er mit seinen griechischen Gewändern Farbe ins verschlafene Frankenstädtchen. Es geht auch um den volksnahen Prinzregenten Luitpold, der 91 Jahre alt wurde. Und es geht um Karl Theodor, dem München den Englischen Garten und indirekt auch den Stachus verdankt. Wäre er nicht so unbeliebt gewesen, hätten die Münchner ihn nach dem Wirt Eustachius Föderl gleich Karlsplatz und nicht Stachus genannt.

Das Museum zeigt auch Werbeplakate, die das Landleben beschönigen: Eine Magd mit blütenweißer Schürze gießt Milch in ein Gefäß, ein Bursche spielt dazu Mundharmonika. Sie malen ein klischeehaftes Bild vom heilen bayerischen Landleben, als die Verelendung mit der Industrialisierung längst auch Bayern erreicht hatte. Die Nazizeit wird thematisiert, die schrecklichen Erlebnisse der Wittelsbacher, die als Sippenhäftlinge von einem KZ ins nächste verschleppt wurden.
Vogelfrei zu sein und bei jedem Öffnen der Tür Angst haben zu müssen, erschossen zu werden, macht etwas mit den Menschen. Der Rundgang in diesem Museum im Schlosspark endet im Porzellanzimmer mit dem goldenen Hochzeitsservice Ludwigs III. und seiner Frau. Vielleicht war es ein Tanz auf dem Vulkan, noch 1918 zu feiern, als alles in Schutt und Asche lag. Vieles reimt sich hier, vieles passt zusammen. Beeindruckend sind auch die 3D-Animationen weiterer Baupläne des Kinis. Der chinesische Palast am Plansee? Hätte er doch noch mehr gebaut, mag sich die Tourismusindustrie denken …
Entdecke mehr von ALPENJOURNAL
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.